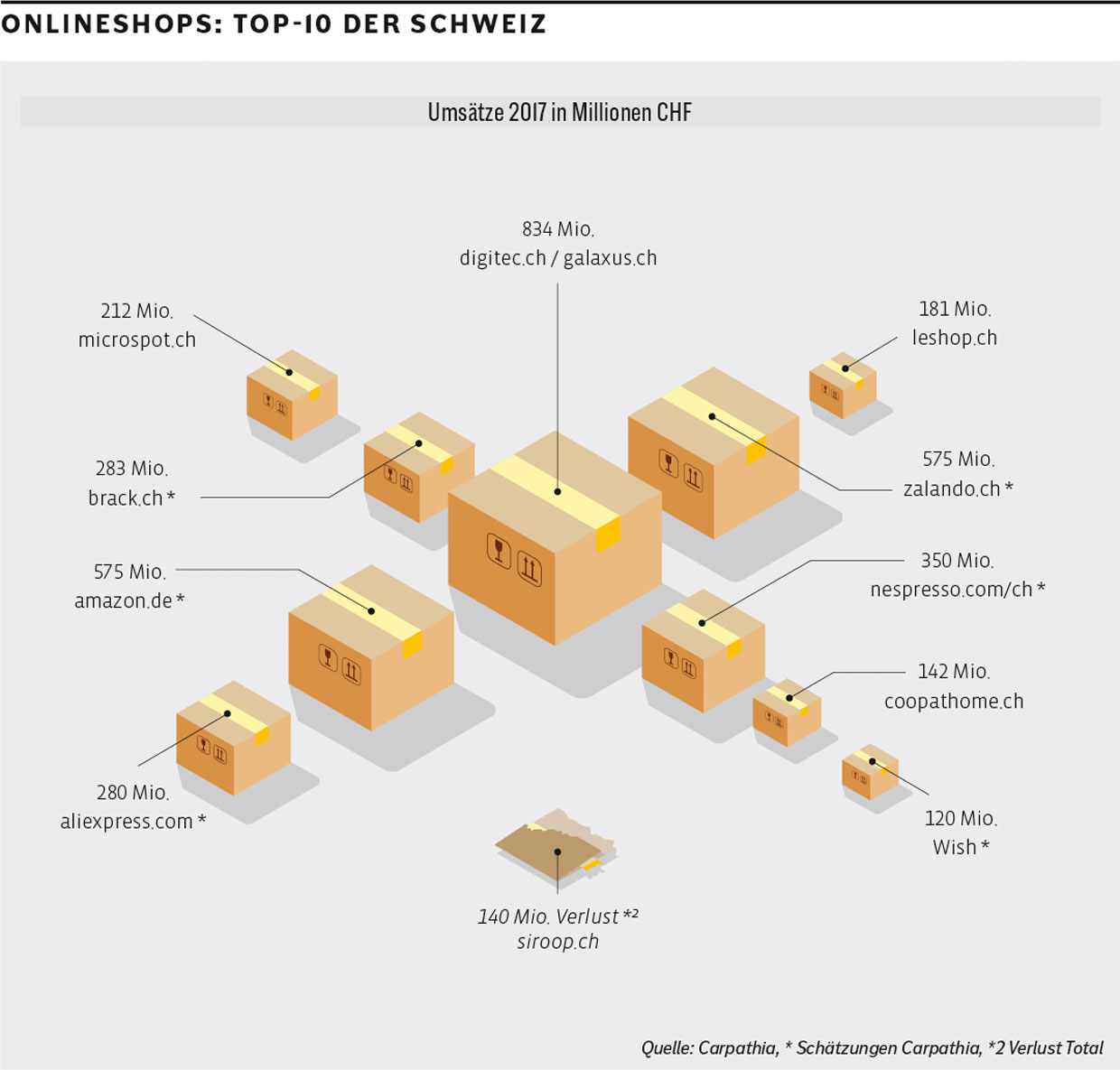Die Techgiganten sind die Götter unserer Zeit, ihre riesigen Plattformen der Olymp. Ob beim Kundenerlebnis, auf dem Finanzmarkt oder in Sachen Zukunftsvisionen: Die schiere Dominanz der Superkonzerne ist beispiellos.
Text: Pascal Hügli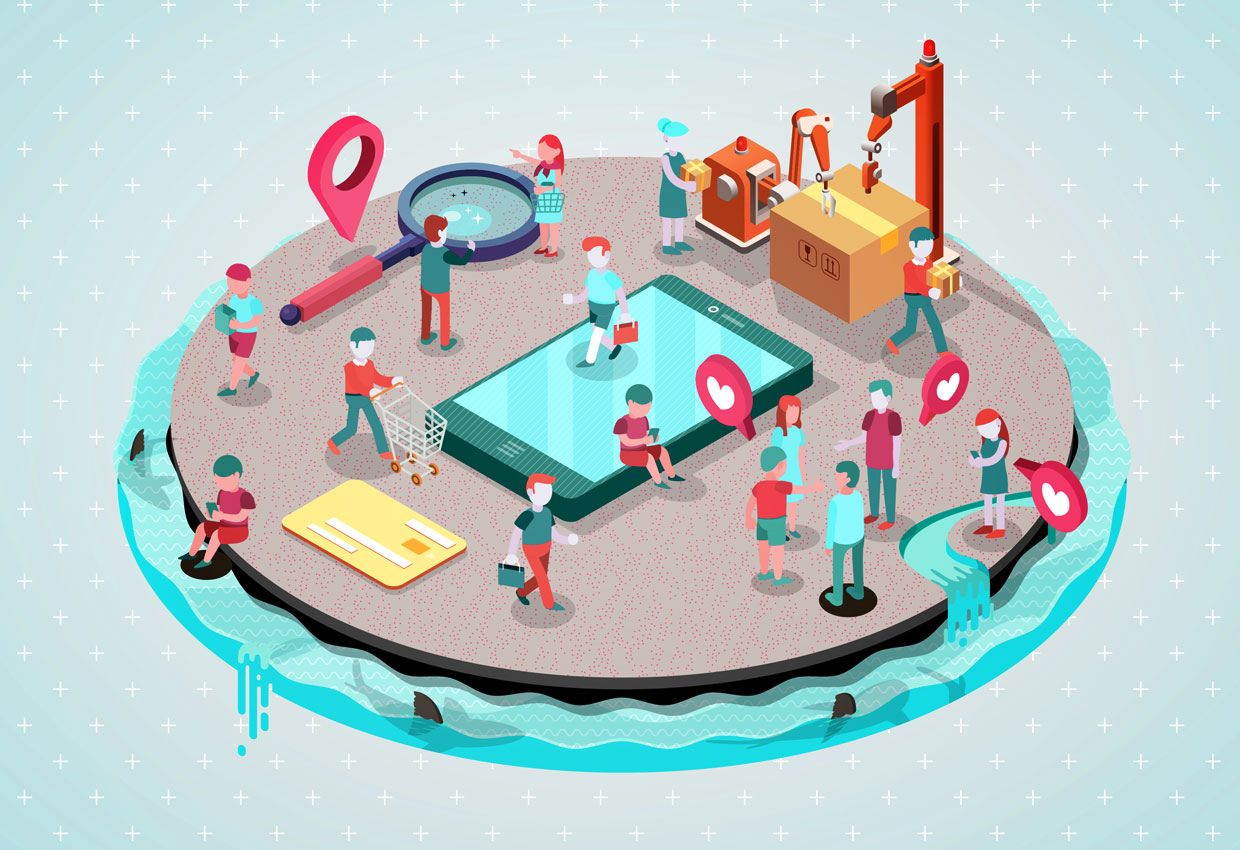
Die Plattform-Ökonomie wächst nicht einfach nur stetig, sie bricht am Laufmeter Rekorde. Im ersten Halbjahr haben die 60 wertvollsten Plattformen rund eine Billion Dollar zugelegt, zusammen kommen sie nun auf eine Marktkapitalisierung von sieben Billionen. Die Billionen-Grenze als erstes geknackt hat Apple, doch Amazon, Alphabet, Microsoft und Co. sind dem teuersten Unternehmen der Welt dicht auf den Fersen.
In Asien machen vor allem Alibaba, Tencent und Samsung auf sich aufmerksam. Diese Plattformen sind nicht nur auf dem Papier wertvoll, sie prägen auch das Leben von Millionen von Menschen und haben somit eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Wer das für übertrieben hält, soll sich folgende Frage stellen: Könnte ich meinen Alltag ohne soziale Kommunikation, Smartphone, E-Mail, Suchmaschine, EBook, Computer oder Streaming bestreiten? Ein Leben ohne Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, Gmail, iPhone, Samsung, Amazon, Windows, Apple-TV oder Netflix? Wer den Selbstversuch wagt, merkt: Die Opfer auf dem Altar der digitalen Gottheiten sind riesig.
Einfach unentbehrlich
Dass die Plattformen derart gross werden konnten, ist auf ihre wichtigste Eigenschaft zurückzuführen: Netzwerkeffekte, die zu einer sich selbst verstärkenden Wachstumsdynamik führen. Der Nutzen eines Netzwerkes hängt von der Nutzerzahl ab. Mit jedem weiteren Teilnehmer steigt der Nutzen, wovon auch die bestehenden Netzwerkmitglieder profitieren. Der ursprünglich durch die Industrialisierung ermöglichte Massenwohlstand hat insbesondere viele Konsumgüter austauschbar gemacht. Nur logisch, dass Konsumware heute vielfach für selbstverständlich gehalten wird und die Wertschätzung ihr gegenüber abgenommen hat. Auch scheinen die in der «alten Welt» entscheidenden Produktionsfaktoren – noch immer werden in den Wirtschaftslehrbüchern Land, Arbeit und Kapital als bestimmende Wirtschaftskomponenten ausgewiesen – in unserer heutigen Welt, in der die Knappheit scheinbar überwunden worden ist, nicht mehr das Mass aller Dinge zu sein. An ihre Stelle ist die Schnittstelle zum konsumierenden Menschen getreten – die Plattform ist selber zum wichtigsten Produkt geworden. Entscheidend dabei: Lassen sich Geschäfte mit Konsumgütern und Dienstleitungen bequem über die Plattform abwickeln, verschiebt sich das Gewicht von den ersetzbaren Konsumgütern und Dienstleistungen weg – hin zur unersetzlichen Plattform. Wieso selber nach Gold schürfen, wenn man die unentbehrlichen Schaufeln verkaufen kann?
Wertvoll ist die Plattform für deren Betreiber aber nicht bloss, weil sie zum Dreh- und Angelpunkt der Konsumenten wird – sie verschafft zudem Zugang zu Unmengen persönlicher Daten. Was im 19. Jahrhundert das Öl war und die Machtstellung von Standard Oil begründete, ist heute die Information über den Kunden. Die Plattform erhält nicht nur bei jedem Kauf eine kleine Gebühr, sondern kann darüber hinaus das Kaufverhalten seiner Mitglieder auswerten und monetarisieren.
Überall die Finger im Spiel
Doch die grossen Plattformbetreiber haben nicht «nur» den Zugang zur Kundenschnittstelle, der ihnen Unmengen an Daten beschert. Auch sonst haben sie sich geschickt in die wertvollen Wertschöpfungsketten des Digitalzeitalters eingenistet. Amazon, Google und Microsoft stellen zusammen über 60 Prozent der gesamten Cloud-Storage-Dienste. Wer Inhalte im Internet speichern und zur Verfügung gestellt haben will, kommt somit an den Tech-Giganten kaum vorbei – auch Netflix nicht. Alle Filme, die man beim grössten Videostreaming-Anbieter sehen kann, lagern auf den Servern von Amazon. Der Instant-Messaging-Dienst Snapchat setzt beim Cloud-Hosting auf Google: Ungefähr die Hälfte von Snapchats Einkünften fliessen dadurch an den Internet-Riesen.
Die Tech-Giganten dominieren weitere Bereiche des Internets, etwa die App-Stores oder das Werbegeschäft. Wer seine Applikation an den Mann und die Frau bringen will und diese auch noch bewerben möchte, muss für ersteres entweder die Dienste von Apple oder Google und für letzteres jene von Facebook oder Google in Anspruch nehmen. Amazon war diesbezüglich Vorreiter mit der 2009 lancierten Eigenmarke AmazonBasics. Vorgesehen war, unter der Hausmarke Amazon preiswertes Elektronikzubehör wie Kabel oder Stecker zu verkaufen. In der Zwischenzeit ist die Produktpalette von AmazonBasics-Gütern von ungefähr 200 auf über 1500 Produkte angewachsen – und die wahre Absicht scheint sich zu offenbaren: Gut möglich, dass Amazon die Verkaufsdaten möglichst genau zu analysieren versucht, um dann die begehrtesten Produkte zu kopieren und via Eigenmarke an den Kunden zu bringen. Die Einführung Alexas – der virtuellen Sprachassistentin für zuhause – dürfte diese Strategie vervollständigen, liegt deren Nutzen für Amazon doch in der Selektion. Während Kunden, die bei Amazon einkaufen, derzeit Zugang zu einer Vielzahl von Marken haben, könnte Alexa diese Auswahl nach und nach eliminieren. Die virtuelle Sprachassistentin würde dann standardmässig das AmazonBasics-Produkt anbieten.
Wie ein wuchernder Tumor
Auch ins Feld der Finanzdienstleistungen wollen die Techgiganten vorstossen – erneut mit Amazon an vorderster Front. Geplant ist nicht eine traditionelle Bank für jedermann, der Fokus liegt auf den Kernkompetenten des modernen Bankings: Amazon Pay, Amazon Cash und Amazon Lending sind nur ein paar der Finanzangebote, mit denen die Kundenakquisition für das eigene Plattformgeschäft vorangetrieben werden soll.
Es ist dasselbe Vorgehen: Amazon baut die Kernproduktsäulen für sich selber aus – und wird selbst zum grössten Kunden der eigenen Produkte. Erst nach Jahren des Aufbaus und Testens bringt der Techgigant die Produktesäulen auf den Markt und stellt sie Drittkunden zur Verfügung. So geschehen mit Amazon Web Services, die der Verbesserung interner Cloud-Kapazitäten dienten und erst später extern angeboten wurden. Die schier grenzenlose Spannweite der digitalen Superkonzerne und die damit verbundene Dominanz ist beispiellos. Und selbst in den wenigen Bereichen, in denen sie derzeit nicht dominant sind, wollen sie sich künftig breitmachen. Sie breiten sich aus wie ein wuchernder Tumor, von dem man nicht weiss, ob er gut- oder bösartig ist.
Doch sollte dieser Umstand die Hoffnung auf mögliche Disruption nicht trüben, immerhin wurde so mancher der digitalen Giganten selbst einmal in einer Garage gegründet. 2008 war mit Microsoft gerade einmal ein Techgigant unter den zehn wertvollsten Unternehmen – zehn Jahre später sind es deren sieben. Warum also sollten nicht neue Start-ups den Riesen ihre Stellung wieder streitig machen? Google, Amazon und Co. hatten den Vorteil, dass sie das Internetzeitalter in seinen Anfängen prägen konnten. Start-ups, die heute ihre Ideen verwirklichen wollen, finden bereits eine höchst funktionale Digitalwelt vor. Um in dieser voranzukommen, sind Emporkömmlinge auf die Dienste der Etablierten angewiesen. Gewinnt ein Jungunternehmen an Fahrt, profitiert einer der Platzhirsche immer mit. Diese Erfahrung machen nicht nur Netflix und Snapchat, wie die bereits geschilderten Beispiele gezeigt haben.
Im Fall von Snapchat ging die Tragik gar noch weiter, das Unternehmen musste eine weitere bittere Pille schlucken: Mit der «Story-Funktion» – eine mit persönlichen Fotos ausgeschmückte Slideshow des Tages, die nach 24 Stunden wieder verschwindet – setzte der Dienst einen neuen Trend in der Welt der sozialen Kommunikation. Daraufhin versuchte Facebook, Snapchat für drei Milliarden Dollar zu kaufen – das Angebot wurde abgelehnt. Also kopierte Zuckerberg die «Story-Funktion» und integrierte sie in Facebook, Instagram und WhatsApp, womit er Snapchat einen
herben Schlag versetzte. Die digitalen Supertanker kennen letztlich keine Gnade: Entweder versuchen sie sich die Start-ups möglichst früh einzuverleiben – Google besitzt hierfür mit Google Ventures sogar einen Risikokapitalfonds, der die Tech-Welt auf neue interessante Ideen abgrast – oder sie kopieren ganz einfach ihre besten Ideen.
Konvergenz der Horte
An Finanzkraft fehlt es ihnen folglich nicht: Spitzenreiter Apple sitzt auf einem Cashbestand von über 285 Milliarden Dollar. Bei Microsoft ist es knapp die Hälfte, bei Alphabet etwa 100 Milliarden Dollar. Sie sind aber nicht nur selber grosse Bargeldhorter, auch ihre Aktien werden von gewissen Investoren immer häufiger gehortet. In einer widersprüchlichen Zeit, in der sich die Politik des Quantitative Tightening abzeichnet, gleichzeitig alleine die USA in diesem Jahr Staatsanleihen im Wert von bis zu einer Billion Dollar zeichnen werden, scheinen immer mehr Investoren einen Teil ihres Vermögens in den grossen Tech-Aktien zu parken. Der Kapitalzufluss in den Technologie-Sektor über die erste Juniwoche 2018 war der zweitgrösste, den die Märkte je gesehen haben. Während andere Sektoren im Zuge der restriktiver werdenden Politik der US-Notenbank Abflüsse zu verzeichnen haben, gebärdet sich der Tech-Sektor als regelrechte Anlageoase. Selbst als Netflix Mitte Juli schlechtere Quartalszahlen als erwartet publiziert hat, tat dies der Euphorie der Anleger kaum Abbruch.
Aus Sicht eines Anlegers stehen Google-, Amazon- oder Apple-Titel der Mehrheit der Staatsanleihen in Sachen Liquidität in nichts nach – nur eine US-Staatsanleihe wird wohl als noch liquider angesehen. Es ist diese unheimliche Dominanz auf den Aktienmärkten, die einige Anleger beunruhigt. Denn mittlerweile machen alleine die FAANG-Aktien, ein Akronym für die Tech-Unternehmen Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google-, mehr als 15 Prozent des S&P 500 aus. Kursveränderungen dieser Unternehmen haben einen gewichtigen Effekt auf den Index. Exemplarisch verdeutlichte dies Facebooks beachtlicher Taucher Ende Juli: Mit über 20 Prozent Kursverlust an einem Tag war das eine Rekordmarke – noch nie in der Finanzmarktgeschichte der USA sank der Kurs eines Unternehmens innerhalb eines Tags stärker. Der Kursrückgang des Social-Media-Giganten zog andere Unternehmen, insbesondere dessen Konkurrenten, in Mitleidenschaft.
Min Grund für die Höchstkurse findet sich zudem im zeitgleichen Aufstieg der passiven Anlagewelt. Während die FAANG-Aktien 2008 bei erst neun ETF zu den Top-15-Beständen gehörten, tun sie es heute bei deren 605. Die überwiegende Mehrheit von Indizes und ETF investiert auf der Basis der Marktkapitalisierung. Das hat zur Folge, dass grosse Titel – allen voran jene der Techgiganten – überdurchschnittlich von passiven Zuflüssen profitieren. Für den Anleger resultiert eine überproportional hohe Rendite, da sich die Übergewichtung der FAANG-Aktien positiv auf den Portfoliowert auswirkt. Gleichzeitig ist der Investor von ein paar wenigen grossen Technologie-Titeln abhängig, obwohl er glaubt, über einen ETF in einen diversifizierten US-Aktienmarkt zu investieren. Wenn das FAANG-Klumpenrisiko vermieden werden soll, bieten sich gleichgewichtete ETF an. In diesen machen die FAANG zusammen nicht mehr 15, sondern bloss noch ein Prozent des Gesamtindexes aus. Die Versuchung, sich die derzeitige Dominanz von Apple und Co. über einen marktgewichteten ETF zu Nutze zu machen, ist gross. Angesichts ihrer Projekte und Aussichten halten Analysten ein weiteres Wachstum für möglich. Nicht zuletzt deshalb, weil Zukunftsbereiche wie maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz oder selbstfahrende Autos durch sie vorangetrieben werden.
Die Einsätze sind riesig
Dass für einige die derzeitigen Finanzmarktbewertungen ans Groteske grenzen, ist nachvollziehbar. In den vergangenen Jahren waren es die FAANG-tastischen Fünf, die den bereits neun Jahre anhaltenden Bullenmarkt befeuert haben. Doch wird dieser nicht ewig anhalten können. Es gibt Befürchtungen, wonach eine stärkere Regulierung den Plattformgiganten und ihren Aktienkursen zusetzen könnte. Angesichts der magischen Bewertungen und immer neuer Rekorde ist es zudem nicht unplausibel, von einem sogenannten Crack-up-Boom zu sprechen. Damit sind Aktienmarkthochs gemeint, die sich zu einem überwiegenden Teil aus Angst vor Kursverlusten speisen. Völlig unbegründet ist diese Beschreibung nicht: Apple wird zu über 60 Prozent von institutionellen Investoren gehalten, Google, Facebook und Microsoft sogar zu über 70 Prozent. Beachtliche Kursrückgänge bei den FAANG-Titeln würden die institutionellen Anleger – und damit auch die einfachen Sparer und Vorsorger – schwer treffen. Wer hoch fliegt, kann eben auch tief fallen.